Das war schon zur Zeit der Apostel so.
Christian Haslebacher, 02.05.2025
“Ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, […]
dass durch meinen Mund die Heiden
das Wort des Evangeliums hörten und glaubten.” (Apg 15,7)
Diese Aussage von Petrus steht im theologischen[1] Zentrum und in der Mitte der Apostelgeschichte des Lukas. Sie zeigt neben diversen anderen Stellen dieses biblischen Buches,[2] dass es in der Urkirche offenbar ein Verständnis darüber gab, was dieses “Wort des Evangeliums” ist, das zu glauben man die Menschen einlud. Um diesem urchristlichen Verständnis des Evangeliums auf die Spur zu kommen, analysierte ich alle Predigten in der Apostelgeschichte:
| Apg 2,14–40 | Petrus zu Juden an Pfingsten |
| Apg 3,12–26 | Petrus zu Juden nach Heilung im Tempel |
| Apg 4,8–12; Apg 4,19–20 | Petrus vor dem Hohen Rat nach Heilung im Tempel |
| Apg 4,24–30 | Gebet der Gemeinde nach Verhandlung vor dem Hohen Rat |
| Apg 5,29 | Petrus und die Apostel vor dem Hohen Rat |
| Apg 7,2–56 | Stephanus vor dem Hohen Rat |
| Apg 8,5; Apg 8,12–14 | Philippus zu Samaritern |
| Apg 8,32–39 | Philippus zum äthiopischen Kämmerer |
| Apg 9,20–22; Apg 9,28 | Paulus zu Juden in Damaskus und Jerusalem |
| Apg 10,34–48 | Petrus zu Heiden in Cäsarea |
| Apg 13,16–48 | Paulus zu Juden in Antiochien |
| Apg 14,3; Apg 14,7 | Paulus und Barnabas zu Juden in Ikonion |
| Apg 17,2–3; Apg 17,7 | Paulus und Silas zu Juden in Thessalonich |
| Apg 17,22–31 | Paulus zu Griechen auf dem Areopag |
| Apg 20,17–35 | Paulus zu den Ältesten von Ephesus |
| Apg 22,1–21 | Paulus zu Juden in Jerusalem |
| Apg 26,2–29 | Paulus zu König Agrippa in Cäsarea |
| Apg 28,31 | Paulus zu den Heiden in Rom |
Ich untersuchte, welche Grundaussagen in diesen Predigten jeweils gemacht wurden. Ich stellte fest, dass gewisse Aussagen immer wieder vorkommen und andere nur manchmal.
Heute ist es so, dass Referentinnen und Referenten, die regelmäßig über denselben Themenkreis Vorträge halten, oft einen immer gleichen Master-Foliensatz benutzen. Je nach Zuhörerschaft und Vortragsdauer setzen sie eine bestimmte Auswahl an Folien ein, wobei die Reihenfolge variieren und die Wortwahl je nach Publikum etwas unterschiedlich ausfallen kann. Aber grundsätzlich verwenden sie immer denselben Stock an Folien. Im Bild gesprochen stellt sich für die Apostelgeschichte die Frage: Mit welchem Satz an “Evangeliums-PowerPoint-Folien” zog man zur Zeit der Apostelgeschichte von Stadt zu Stadt und zeigte je nach Kontext und Fragestellung eine Auswahl dieser Folien? Und welche Titel hatten diese Folien?
Ich erkenne in der Apostelgeschichte 10 Grundaussagen, die in den Evangeliums-Predigten verwendet wurden. Diese Aussagen sind einerseits voller Kraft und Schönheit, sie waren schön und kraftvoll. Man nahm damals den “Mund ganz schön voll”. Das war keine “Wischiwaschi-Botschaft”. Gleichzeitig wirkten diese Aussagen in ihrer Absolutheit von Anfang an zum Teil skandalös. Schon damals, zur Zeit der Apostel! Nicht erst heute für aufgeklärte Menschen der Spätmoderne. Die Aussagen waren zum Teil damals skandalös und sind es auch heute noch. Auch auf gläubige Christinnen und Christen.
Ich werde in der Folge diese 10 Grundaussagen aus der Apostelgeschichte auflisten (von 1 bis 10 nummeriert) und erklären, welche 12 schönen, kraftvollen und skandalösen Konsequenzen (von A bis L durchbuchstabiert) sich daraus ableiten. Wie wir sehen werden, sind uns die 10 Grundaussagen längstens bekannt. Am Schluss werde ich zwei Fazits aus allen Beobachtungen ziehen, welche für die Christenheit heute wesentlich sind. (Am Ende dieses Artikels findet sich eine tabellarische Übersicht.)
Die erste Grundaussage der Predigten der Apostelgeschichte lautet:

1. Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde,[3] der Vater.[4]
Diese Aussage beinhaltet mindestens zwei Konsequenzen, die einerseits schön und kraftvoll sind, andererseits aber auch skandalös:
A: Gott, dem heiligen Schöpfer, gebührt die höchste Ehre. – Allein diesem Gott.
Wenn Gott der Schöpfer ist, dann können wir ihn nicht wie einen Clown oder eine etwas einfältige Person behandeln, sondern dann sind ihm seine Geschöpfe die höchste Anerkennung schuldig. Dies in einer speziellen, exklusiven Weise wie niemandem sonst in gleichem Masse: “Allein diesem Gott”. Das bedeutet:
Es geht im Leben nicht primär um uns, sondern um etwas viel Größeres, Schöneres und Erhabeneres als wir: Unser ganzes Sein, Handeln und Reden soll den heiligen Gott ehren.[5] Es ist uns Ehre und Vorrecht, Gott dienen zu dürfen.
Gott ist der Schöpfer der Welt, sie trägt seine Handschrift und wird von ihm erhalten. Gott ist aber selbst nicht Teil dieser Welt. Wie ein Kunstmaler nicht selbst im Bilderrahmen lebt, der die Grenzen seines Bildes definiert, ist Gott im Gegensatz zu uns weder an räumlichen Ort noch an Zeit noch an Materie gebunden. Gott “spielt in einer völlig anderen Liga” als wir. Wir können sein Wesen, Denken und Handeln nur teilweise begreifen. Er ist der souveräne Gebieter unserer Welt.[6] Er ist für uns Menschen unverfügbar und uns keine Rechenschaft schuldig.[7] Im Gegenteil: Er ist unser gerechter Richter.[8]
Die christliche Botschaft vermittelt uns die Faszination, an den erhabenen, wunderbaren, mit Worten kaum zu beschreibenden Schöpfer zu glauben. Ohne heiligen und gerechten Schöpfergott, dem die höchste Ehre und Autorität gehören, gib es auch keinen Gott als liebenden Vater,[9] Tröster[10] und Helfer.[11] Gleichzeitig bedeutet dies, dass alle anderen nicht Gott sind: Nicht die anderen Götter, keine noch so mächtigen Menschen und nicht etwa wir selbst. Das ist ein Skandal.
Die zweite Konsequenz aus der ersten Grundaussage der Evangeliums-Verkündigung in der Apostelgeschichte lautet:
B: Das Geschaffen-Sein durch Gott garantiert im Letzten die einzigartige Würde aller Menschen, von Mann und Frau. – Allein dieses Geschaffen-Sein.
Die Würde jedes Menschen ist unantastbar, weil wir Gottes Kunstwerke und Ebenbilder sind. Wir dürfen Gott für das Wunder des Lebens und dass wir “wunderbar gemacht” sind, danken.[12] Wie ein König, dessen Ehre getroffen wird, wenn seine Ebenbilder (z.B. Statuen und Wandbilder) besudelt werden, wird auch Gottes Ehre getroffen, wenn wir durch andere oder uns selbst Entwürdigung und Misshandlung erleben.
Gott schuf den Menschen als Mann und Frau mit einer biologischen Polarität, die in aller Regel bis in die letzte Körperzelle hinein sichtbar wird.[13] Während des irdischen Lebens bilden die Biologie des Körpers und die Seele eine identitätsstiftende Verwobenheit. Wir alle müssen mit Einschränkungen existieren, sowohl körperlich, sexuell, als auch psychisch, kognitiv, charakterlich und geistig.[14] Wir reden Unheiles nicht klein oder heißen es gut. Unter unterschiedlichen Voraussetzungen sollen wir so zu leben lernen, dass wir Gott dadurch ehren und wie es unserer Würde als von ihm geschaffene Wesen entspricht. Darin dürfen Gläubige mit der Hilfe des Heiligen Geistes rechnen.[15]
Wenn der Schutz der Würde und des Lebens nicht für alle Menschen – auch für kranke, gebrechliche und ungeborene – gilt, ist letztlich die Unantastbarkeit der Menschenwürde für uns all in Frage gestellt.
Die christliche Botschaft vermittelt uns die Faszination, trotz zum Teil großen Widrigkeiten mit einer unantastbaren Würde beschenkt zu sein. Ohne Geschaffen-Sein durch Gott gibt es keine letzte Grundlage für die körperliche und seelische Würde des Menschen, die Würde des Lebens und die Würde der Schöpfung. Und auch das ist eben eine skandalöse Aussage: Mit Gott als Schöpfer haben wir eine unantastbare Würde und sonst in dieser Klarheit nicht.
Die erste Grundaussage aus der Apostelgesichte, “Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde, der Vater.”, ist uns sehr gut bekannt. Das Apostolische Glaubensbekenntnis beginnt mit den Worten: “Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.” – Das Apostolische Glaubensbekenntnis geht in seinen Aussagen inhaltlich auf die “Richtschnur des Glaubens” zurück,[16] wie sie spätestens seit 200 n.Chr. von Irenäus und Tertullian[17] sowie vom Schüler Irenäus’ Hippolyt von Rom (170–235) offiziell als Taufbekenntnis[18] überliefert wird (vgl. Plädoyer für das Apostolische Glaubensbekenntnis – den zeitlosen Klassiker). – Der zuweilen geäusserte Vorwurf, das Apostolische Glaubensbekenntnis verfehle das Zentrum des christlichen Glaubens, weil darin (wie auch in der gesamten Apostelgeschichte!) nicht von der Liebe Gottes[19] die Rede sei,[20] greift zu kurz. Das erste Attribut, das Gott zugeschrieben wird, ist “Vater”, wobei vom neutestamentlichen Sprachgebrauch her immer auch an “Liebe” zu denken ist.[21]
Die zweite Grundaussage aus der urkirchlichen Evangeliums-Verkündigung lautet:

2. Jesus ist König (Christus)[22] und richtet das Königreich Gottes auf.[23] Jesus ist Gottes Sohn.[24] Jesus ist Herr.[25]
In der Konsequenz bedeutet dies:
C: Christus regiert als höchster König seiner Kirche und der ganzen Welt. – Allein dieser Christus.
Jesus ist nicht lediglich Vorbild, Lehrer, Prophet, Freund und Bruder. Als menschgewordener Gott (Sohn Gottes) ist Jesus oberste Autorität unter den Menschen, die Gott dienen. Er ist der König von Gottes angebrochenen Königreich,[26] der rechtmäßige König der ganzen Welt,[27] wobei “Christus” sein Königstitel ist.[28]
Seine Wunder[29] bis hin zu seiner leiblichen Auferstehung sind kein Mythos und bestätigen ihn als menschgewordenen Schöpfer. Nur weil Jesus auferstand, gibt es einen lebendigen Glauben an einen lebendigen Jesus (vgl. E).[30] Er wird einmal sichtbar regieren.
Seine Worte und Taten sind liebevoll und faszinierend und teilweise irritierend. So auch die Aussage, dass er uns trotz teilweisen großen Versagens nach wie vor liebt und an seiner Berufung für uns, ihm nachzufolgen, festhält (vgl. K).
Die christliche Botschaft vermittelt uns die Faszination, dem König dieser Welt und der Ausbreitung seines Reiches im Hier und Jetzt zu dienen. Ohne Jesus als auferstandener König (Christus) und oberste Autorität gibt es dem Wortsinn nach keinen christlichen Glauben, keinen Christen und keine Christin und keine christliche Kirche. Der Skandal liegt nicht im Anspruch, dass Jesus ein König ist, sondern der höchste König.
Auch diese Grundaussage ist uns aus dem Apostolischen Glaubensbekenntnis wohlbekannt: “Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn”.

3. Jesus wurde gemäss Gottes Willen von der jüdischen Führung und Pilatus ans Kreuz gebracht.[31]
4. Jesus schenkt uns Vergebung der Sünden.[32]
Auch diese Punkte der urchristlichen Predigt werden im Apostolischen Glaubensbekenntnis aufgenommen: “gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes” und “Ich glaube an […] die Vergebung der Sünden”.
Diese zwei Aussagen werden in der Apostelgeschichte mindestens andeutungsweise miteinander verknüpft (Apg 3,18–19; 17,2–3; 20,28; 26,18.23; vgl. 8,32–35 mit Jes 53,5–8). Andernorts in der Bibel wird klar gesagt, dass die Vergebung mit dem Kreuz zu tun hat,[33] weshalb ich sie hier zusammennehme. Die Konsequenz dieser zwei Aussagen ist:
D: Gnade und Kreuz schenken uns im Letzten eine versöhnte Beziehung mit Gott. – Allein Gnade und Kreuz.
Am Kreuz erlebte Jesus die maximale Entwürdigung, um uns aus unserer Entwürdigung (“Sünde”) und Zerbrochenheit zu befreien. Jesus starb für uns, für unsere Befreiung. Das Mordinstrument des Kreuzes wurde zum Symbol des ewigen Lebens.[34]
Exklusiv daran ist: Durch sein Sterben demonstrierte Jesus nicht nur Gottes Liebe für uns, sondern eröffnete uns den einzigen Weg zu Gott. Das Kreuz Jesu ist also nicht lediglich “heilsillustrativ”, sondern in zentraler Weise “heilskonstitutiv”. Inklusiv daran ist: Dazu sind alle Menschen gratis (lateinisch “aus Gnade”) eingeladen (vgl. K).[35] Es ist ein Werk des Heiligen Geistes, dass wir erkennen, dass wir das brauchen (vgl. H).[36]
Die christliche Botschaft vermittelt uns die Faszination, als Begnadigte in Freiheit und Versöhnung zu leben. Dass das schändliche Kreuz der einzige Weg zur Vergebung sein soll, wird als Skandal verstanden.[37] Trotzdem ist das “Wort des Evangeliums” (Apg 15,7) beziehungsweise das “Wort des Herrn”[38] zu einem wesentlichen Teil das “Wort des Kreuzes” (1Kor 1,18). Ohne Kreuz im Zentrum verliert die Evangeliumsbotschaft ihre Grundlage und rettende Kraft.[39]

5. Gott bestätigte Jesus durch die Auferweckung, Erhöhung in den Himmel[40] und Wunder in seinem Namen[41] als Christus (König).
E: Die Auferweckung und Erhöhung Jesu schenken uns eine ewige Hoffnung. – Allein die Auferweckung und Erhöhung Jesu.
In der Apostelgeschichte werden die Apostel sehr wesentlich als “Zeugen der Auferstehung” beschrieben.[42] Dass Jesus am Kreuz litt und von den Toten auferstand, bestätigt ihn als Christus.[43] So verkündete Paulus das Evangelium von Jesus und der Auferstehung.[44] Dass Jesus den Heiligen Geist vom Himmel auf die Erde sandte (vgl. H), bestätigt seine Erhöhung zur Rechten des Vaters.[45]
“Dass Jesus von den Toten auferstanden ist, ist ein Kernelement des christlichen Glaubens. Ohne diese Aussage gäbe es den christlichen Glauben nicht in der Weise, wie wir ihn heute kennen. Jesus wurde abgelehnt und zum Tode verurteilt. Nun aber wandte Gott dieses Urteil ins Gegenteil. Wenn der Tod von Jesus scheinbar bewies, dass Jesus eben nicht menschgewordener Gott und König war, dann bewies seine Auferstehung, dass er es eben doch ist. Die Auferstehung rehabilitierte Jesus”.[46] Die Aussicht auf die Auferstehung und Erhöhung gab Jesus Kraft für seinen Leidensweg.[47]
Die christliche Botschaft vermittelt uns die Faszination, einmal wie Jesus aufzuerstehen[48] und in einem wörtlichen Sinn das “ewige Leben” zu haben,[49] das über diese Welt mit ihren Herausforderungen und Nöten hinausgeht (vgl. G). Ohne Auferstehung von Jesus gäbe es diese Hoffnung nicht und keine Beziehung zu Jesus. Jesus wäre nicht als König bestätigt[50] und könnte nicht als Fürsprecher und Priester für uns eintreten.[51] Ohne Auferstehung von Jesus wäre die Evangeliums-Verkündigung und der christliche Glaube schlussendlich völlig sinnlos.[52] Aber natürlich ist der Glaube an eine körperliche Auferstehung seit jeher ein Skandal.[53]
Trotzdem war die Auferstehung von Anfang an Teil der “Glaubensregel” (regula fidei) und des Apostolischen Glaubensbekenntnisses: “am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters”.

6. Gott hat Jesus durch die Schrift als Christus (König) bestätigt.[54]
In der Apostelgeschichte wird immer wieder betont, dass die Ereignisse um Jesus und seine Messianität in Übereinstimmung mit der Schrift stehen. Dies folgt der Überzeugung:
F: Die Bibel ist der letztgültige Maßstab für unseren Glauben und unser Leben. – Allein die Bibel.
Die Bibel ist ein faszinierendes und monumentales Werk, das die dramaturgische Gesamthandlung von Schöpfung bis Neuschöpfung beschreibt. Sie kommuniziert bedeutungsvollste Philosophie und mystische Offenbarung.
Die Bibel gibt uns tiefgründige Antworten, wie Gott zu Fragen unserer Beziehung zu ihm sowie unseres Umgangs miteinander und mit der Schöpfung steht. Sie zeigt uns, was unserer Würde entspricht und Gott ehrt und was nicht. Aus ihr lassen sich verlässliche Lehraussagen (Dogmen) über Gott und die Welt und uns selbst formulieren. Durch diese werden wir zu einer entsprechenden Lebensweise (Ethik) herausgefordert, überfordert und in der Kraft des Heiligen Geistes bevollmächtigt.
Jesus bezeichnet das Alte Testament als “Gottes Wort”.[55] Die Alte Kirche, in deren Tradition wir stehen, weitete diese Sicht der göttlichen Inspiration[56] bei der Definition der biblischen Bücher auf die neutestamentlichen Schriften aus. Das bedeutet, dass wir die Bibel als Gottes Reden und die von ihm inspirierte Botschaft für uns verstehen. In diesem Sinn beinhaltet die Bibel nicht lediglich Gottes Wort, sondern sie ist Gottes Wort für uns.
Die christliche Botschaft vermittelt uns die Faszination, Gott neben seinen Offenbarungen in der Natur, in der Geschichte und in persönlichen Gotteserfahrungen auch aus dem Lesen der Bibel immer besser kennenzulernen (vgl. 11). Wie die Offenbarungen des dreieinen Gottes Glauben wecken wollten,[57] so auch die Bibel.[58] Ohne Vertrauen in die Verlässlichkeit der Bibel fehlt dem Glauben eine solide Grundlage, da wir den dreieinen Gott zu einem sehr wesentlichen Teil aus der Bibel kennen.
Die zahlreichen Verweise auf die Schrift bilden die einzige Grundaussage in den Evangeliums-Predigten der Apostelgeschichte, die im Apostolischen Glaubensbekenntnis im Gegensatz zu anderen Bekenntnistexten keinen Niederschlag fand.[59] Es gilt jedoch zu beachten: Wie bereits erwähnt (vgl. B), formuliert Irenäus in seinem Werk Gegen die Häresien die “Richtschnur des Glaubens” (regula fidei; 1.10.1.), wovon das Apostolische Glaubensbekenntnis eine Variante ist. In derselben Schrift werden die neutestamentlichen Schriften und die “Richtschnur des Glaubens” als zwei Zeugen beschrieben, die sich gegenseitig bestätigen.[60]

7. Jesus wird als Christus (König) und Richter aller Menschen wiederkommen und eine Segenszeit für alle Völker bringen.[61]
G: Die Wiederkunft Jesu macht Christinnen und Christen trotz gegenwärtiger Widrigkeiten zu Optimisten. – Allein die Wiederkunft Jesu.
Als christliche Gläubige sind wir uns der der immensen Herausforderungen und Probleme unsrer Zeit sehr bewusst. Wir sehen nicht weltfremd und naiv über das Schwierige und Katastrophale in der Welt hinweg und verschliessen uns nicht der Nöte unserer Zeit. Trotzdem soll unsere tiefste Grundhaltung die des Optimismus sein (vgl. Christen sind Optimisten).
Gemäss dem biblischen Zeugnis wird Jesus Christus eines Tages sichtbar auf dieser Welt regieren. Er wird sein Friedensreich aufbauen, in welchem Gott als Schöpfer angebetet und Gerechtigkeit herrschen wird.[62] Christinnen und Christen sind aufgerufen, soweit möglich schon heute entsprechend den Massstäben zu leben, die dann gelten werden. Sie sind berufen, von diesem positiven Ende her zu denken, zu reden und zu handeln und dadurch ein “antizipatorischer” Vorgeschmack von dem zu sein, wie es dann sein wird.[63]
Wenn Jesus als Richter wiederkehrt, wird er für alle Opfer kleinerer oder grösserer Unbilligkeiten ewige Gerechtigkeit schaffen. Dies ist die Hoffnung vieler Menschen, die Verletzungen, Gewalt, Hass und Misshandlung erleben. Gott sind solche Dinge nicht egal.[64]
Die christliche Botschaft vermittelt uns die Faszination, in der Zuversicht zu leben, dass Jesus eines Tages sichtbar auf der Erde regieren wird und dass das Beste noch vor uns liegt. Ohne Jesus als gerechten König und Richter gäbe es kein vollendetes Königreich Gottes auf dieser Welt und keine Gerechtigkeit für alle, die auf dieser Welt an Ungerechtigkeit und Misshandlung leiden. Die Vorstellung allerdings, sich einmal vor Christus rechtfertigen zu müssen, ist für viele Menschen ein absoluter Skandal.
Das Apostolische Glaubensbekenntnis erklärt: “von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.” Dann gilt für die Gläubigen: “Ich glaube an […] die Auferstehung der Toten und das ewige Leben”.
Die achte Grundaussage der Predigten in der Apostelgeschichte lautet:

8. Gott hat Jesus durch die Ausgiessung des Heiligen Geistes als Christus (König) bestätigt.[65]
H: Der Geist Gottes und seine Präsenz machen die Kirche im Tiefsten inspirierend. – Allein der Geist Gottes.
Der Glaube an Jesus Christus als Herrn,[66] das Erleben von Gottes Liebe[67] und die Gotteskindschaft[68] sind alles Werke des Heiligen Geistes. Der Glaube entsteht und wächst durch die Begegnung mit dem lebendigen Gott (Vater, Sohn und Heiliger Geist) und nur durch diese Begegnung.[69] Sofern wir Jesus beispielsweise nicht leibhaftig sehen oder den Vater nicht akustisch hören, geschieht die Begegnung mit Jesus oder Vater durch den Geist. Der Glaube entsteht und wächst
- nicht einfach durch richtige theologische Bekenntnisse, so wichtig sie sind, weil sie dem Glauben Inhalt geben (vgl. J),
- nicht einfach durch überzeugende apologetische Argumente, so wichtig sie sind, um Glaubenshindernisse abzubauen,
- nicht einfach durch dienendes Vorleben, so wichtig dies ist, weil es Glaube, Liebe und Hoffnung konkret macht,[70]
- nicht einfach durch gute Beziehungen (Freundschaften, Familie), so wichtig diese sind, weil sich der Glaube in unserer Liebe zeigt,[71]
- nicht einfach durch “zeitgemäße Sucherfreundlichkeit” (Gottesdienste, Jugendanlässe), so wichtig sie ist, weil wir Menschen von hier und heute sind und erreichen wollen,
sondern dann – und nur dann –, wenn wir in all diesen Dingen Gott begegnen. Angelehnt an Karl Rahner: Der Christ der Zukunft wir einer sein, der durch den Heiligen Geist Gott erfahren hat, oder er wird nicht sein.[72]
Deshalb führt die Diskussion, was die Kirche tun müsse, um heute attraktiv und sucherfreundlich zu sein, oft am eigentlichen Kern vorbei. “Es gibt genau eine Sache, die die Kirche attraktiv macht, und das ist die Gegenwart Gottes.”[73] Eine lebendige, leidenschaftliche Spiritualität, in der man die persönliche Begegnung mit dem dreieinen Gott sucht, ist das “Alleinstellungsmerkmal” der Kirche. Das Erleben des Heiligen Geistes und der Wunsch, Außenstehende durch Wort und Tat zu erreichen (Evangelisation und Diakonie), gehen in der Regel einher.[74]
Die Attraktivität der Kirche liegt nicht darin, dass sie dem sogenannten Zeitgeist nach dem Mund redet, weltanschauliche Allgemeinplätze wiedergibt, sich auf diakonisch-soziales Handeln ohne Botschaft konzentriert oder eine profillose “Allerweltsspiritualität”[75] anbietet. Sie liegt ebenso wenig in traditionalistischer oder (möchtegern) moderner Gottesdienstgestaltung, auch nicht in intellektuell abgehobenen oder simplifizierenden Predigten. Die Kirche erreicht dann Menschen, wenn diese in Gottesdiensten, Predigten, diakonischen Liebestaten und der gelebten Gemeinschaft spürbar Gottes Gegenwart und Kraft erleben, sei dies in traditionellen oder zeitgemäßen Formen.
Es geht also darum, als Kirche die Kraft des Heiligen Geistes immer wieder neu zu empfangen,[76] das Evangelium selbst zu glauben und zu erleben und es durch unser Leben, Reden und Wirken weiterzugeben:[77] inspiriert, begeistert, beflügelt, dynamisch. In alledem sollen wir nicht glänzen, sondern durch Gottes Gegenwart in uns leuchten: echt und authentisch.[78]
Die christliche Botschaft vermittelt uns die Faszination, die Gegenwart und Kraft des Heiligen Geistes zu erleben. Ohne Sucherfreundlichkeit, die sich mit authentischer Heiliger-Geist-Spiritualität kombiniert, fehlt der Kirche die Kraft und Dynamik, Menschen für den Glauben an Christus zu gewinnen.
Mit dem Apostolischen Glaubensbekenntnis bezeugt die Kirche: “Ich glaube an den Heiligen Geist”.

9. Jesus erwarb die Gemeinde durch sein Blut.[79]
I: Die Kirche nach neutestamentlichem Vorbild bildet den Teamkontext für ein Leben in der Nachfolge von Jesus. – Allein diese Kirche.
Die Gemeinde nach neutestamentlichem Vorbild hat die Ehre, Tempel und Wohnort Gottes (vgl. H)[80] und die sichtbare Verkörperung (Leib) Jesu zu sein.[81] Sie folgt der Berufung, das Licht und die Hoffnung der Welt[82] und ein Vorgeschmack (Antizipation) dessen zu sein, was sein wird, wenn Jesus sichtbar regieren wird (vgl. G).[83] Dies gilt für Lokalkirchen, Kirchenverbände und christliche Werke, die gemeinsam die weltweite Kirche bilden. Nach zweitausend Jahren Geschichte mit viel Versagen ist die Kirche aufgerufen, sich neu nach dieser Berufung auszurichten und alles auszuräumen, was dem widerspricht.
Kirche ist der Ort, wo man gemeinsam Gottes Gegenwart sucht, am Bekenntnis des Glaubens festhält, sich gegenseitig zu einem entsprechenden Lebensstil der Liebe und guten Werke ermutigt und dies auslebt.[84] Gemeinde ist ein Ort des barmherzigen Mitgefühls, wo Menschen lernen dürfen, heil zu werden und entsprechend ihrer gottgegebenen Würde zu leben.[85]
Der christliche Glaube ist eine “Teamsportart”, in der sich Männer und Frauen unterschiedlichster Herkunft und Lebenssituationen in der Nachfolge Jesu unterstützen und herausfordern.[86] Ein Solo-Christsein ist gemäß dem Neuen Testament und speziell auch der Apostelgeschichte[87] nicht vorgesehen und wo immer möglich zu vermeiden.
Die christliche Botschaft vermittelt uns die Faszination, zu einem lokalen und weltweiten Team zu gehören, wo man sich gegenseitig in barmherzigem Mitgefühl annimmt und in der Jesus-Nachfolge unterstützt. So skandalös dies in einer individualisierten Gesellschaft klingen mag: Ohne Gemeinschaft in der Kirche wird der Glaube schnell oberflächlich, einseitig, selbstgerecht, bequem und willkürlich.
In den Worten des Apostolischen Glaubensbekenntnisses: “Ich glaube an […] die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen”.
In Diskussionen um sexualethische Fragen wird zum Teil argumentiert, das Apostolische Glaubensbekenntnis enthalte dogmatische, aber keine ethischen Aussagen, weshalb solche Fragen nicht zum Kern des christlichen Glaubens gehörten.[88] Diese Argumentation ist aus zwei Gründen nicht korrekt:
1. Im Neuen Testament werden ethische Aussagen immer wieder dogmatisch im Wesen Gottes,[89] Jesu[90] oder des Heiligen Geistes[91] begründet. Paulus benutzt ethische Vergehen als Ausschlusskriterium aus der Gemeinde.[92] In den Kapiteln 2 bis 6 der Didache, der ersten Kirchenordnung von zirka 100 n.Chr., werden diverse ethische Aussagen zu Sexualethik, Lebensrecht, Synkretismus und so weiter gemacht. Die Dogmatik zeigt den Grund der Ethik und die Ethik das Ziel der Dogmatik.[93] “Grundsätzlich gehören also Dogmatik und Ethik unlösbar zusammen.”[94]
2. Im Apostolischen Glaubensbekenntnis ist im selben Satz gleich dreimal von Heiligkeit und einmal von Sünde die Rede: “Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden”. – Dies erinnert an Jesaja 6,3–5, wo vom dreimal heiligen Gott und der Sünde Jesajas und des Volkes die Rede ist.[95] – Die Betonung der Heiligkeit der Gemeinde findet sich neben anderen neutestamentlichen Aussagen auch in der Apostelgeschichte.[96] Mehrfach wir in den neutestamentlichen Briefen betont, die Gläubigen sollten als “Heilige” die “Unzucht” und “jede Art der Unreinheit und Habsucht” meiden.[97] In drastischen Worten erklärt Paulus: “Hütet euch vor der Unzucht! Jede andere Sünde, die der Mensch tut, bleibt außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein [heiliger[98]] Tempel des Heiligen Geistes ist?” (1Kor 6,18–19, Einheitsübersetzung). – Den bekehrten Heiden, die sich der Gemeinde jesusgläubiger Juden anschlossen, wird in der Apostelgeschichte erklärt, sie sollten sich vor Götzenopferfleisch, Blut, nicht-geschächtetem Fleisch und “Unzucht” hüten.[99] Während die Anweisungen betreffend Essen in grossmehrheitlich heidenchristlichen Gemeinden schon von Paulus[100] und generell in der urchristlichen Gemeinde so nicht weitergeführt wurden (in messianisch-jüdischen Kontexten aber nach wie vor zu beachten sein können[101]), wurden die sexualethischen Anweisungen in der Christenheit weiterhin beachtet und unter anderem im 2. Kapitel der Didache aufgenommen. – Wird im Apostolischen Glaubensbekenntnis die Heiligkeit der Gemeinde betont und werden die Gläubigen selbst als “Heilige” bezeichnet, ist dies eine implizite Aussage gegen jedes sündhafte Verhalten der Gläubigen, speziell gegen alle Formen sexueller “Unzucht”.

10. Die Menschen sollen an Jesus glauben,[102] sich von ihrer Bosheit abkehren[103] und sich taufen lassen.[104]
Aus dieser Grundaussage der Evangeliums-Verkündigung der Apostelgeschichte leiten sich mindestens drei Konsequenzen ab.
J: Der Glaube, der die essenziellen Inhalte der christlichen Botschaft bekennt, vermittelt unserem Leben eine einzigartige, faszinierende Bedeutung. – Allein solcher Glaube.
Glaube ist mehr als eine Ahnung oder die persönliche Beziehung zu Gott. Glaube ist das persönliche Bekenntnis zu Gott als Schöpfer und Vater, zu Jesus als König und Retter und zum Heiligen Geist der Kraft und Liebe Gottes.[105]
Bei den hier ausgeführten Inhalten des christlichen Glaubens geht es um das fesselnde, romantische Abenteuer der “Rechtgläubigkeit”. Nie gab es etwas Gewagteres noch Leidenschaftlicheres als sie.[106] Solcher Glaube an den erhabenen Schöpfergott ist viel grösser, als unsere Lebensrealitäten es je sein werden. Er ist schöner und stabiler als alle gesellschaftlichen Trends der letzten zweitausend Jahre bis heute. Solcher Glaube ist nicht dazu gedacht, dass er uns “passt”, sondern dass wir lebenslang mehr und mehr in ihn hineinwachsen. Wer einen Glauben sucht, der ihm oder ihr passt, hat nicht begriffen, dass der biblisch-traditionelle christliche Glaube kein Kleid und keine Wohnung ist, sondern ein Universum. Abstriche in den hier formulierten Glaubensaussagen machen den Glauben nicht etwa weiter, sondern kleiner.
Die christliche Botschaft vermittelt uns die Faszination, einen Glauben und ein Weltbild mit starken Inhalten zu haben, die uns sagen, weshalb und wozu wir ethisch leben und wirken sollen. Ohne Glaubensbekenntnis fehlt der Einladung zum Abenteuer des Glaubens die Klarheit, wozu man freudig “Ja” sagen soll. Wer sich den Glauben selbst Patchwork mäßig selbst zusammenstrickt, muss damit seinem Leben selbst eine Bedeutung suchen.
K: Die Liebe Gottes lädt uns Menschen zu einem Leben mit ihm ein, lässt uns aber auch die Freiheit, leidvolle Entscheidungen zu treffen. – Allein die Liebe.
Gottes Wesen ist Liebe.[107] Sein ganzes Reden und Handeln und was er uns schenken möchte, ist von Liebe geprägt. Dabei ist wichtig: Liebe ist immer freiwillig. Wenn Gott sich Menschen durch die Natur, die Geschichte, durch persönliche Gotteserfahrungen und durch die Bibel offenbart, schränkt er sich dabei so weit ein, dass man an ihn glauben kann, wenn man dazu bereit ist, aber nicht an ihn glauben muss.[108] Ein Glauben-Müssen hätte nichts mit Liebe zu tun.[109] “Liebe ist erst dort, wo zwei Partner in Freiheit sich einander zuwenden.”[110]
Glaube bedeutet: Gott spricht dich persönlich an und du machst ihn zu deinem Meister und folgst ihm nach.[111] Glaube ist ein Abenteuer, zu dem Gott uns einlädt, ein Geschenk, das Gott uns anbietet, ein Ruf, den Gott uns hören lässt. Der Mensch kann diese Einladung, dieses Geschenk und diesen Ruf Gottes nicht von sich aus produzieren, aber ihn hören und annehmen oder auch ablehnen.[112]
Gott lässt den Menschen einen Freiraum, in welchem sie zwischen konstruktiven oder destruktiven Möglichkeiten wählen können.[113] Gott ruft uns beispielsweise zur Nächstenliebe, lässt uns aber auch den Raum zu hassen und einander Böses anzutun, weil Liebe und Freiheit zusammengehören.
Die christliche Botschaft vermittelt uns die Faszination, von Gott aus Liebe zu einem Abenteuer eingeladen zu sein, und die Freiheit, diesem Ruf zu folgen oder auch nicht. Ohne Gottes Liebe gäbe es diese Freiheit nicht und ohne die Freiheit, auch Destruktives und Böses zu tun, gäbe es im Endeffekt auch keine Liebe.
L: Die gebotene Toleranz ruft die Kirche auf, die eigenen Überzeugungen hochzuhalten. – Allein echte Toleranz.[114]
Toleranz bedeutet dabei nicht “die Aufgabe oder Schwächung der eigenen Überzeugungen. Sie bedeutet für jeden einzelnen Freiheit der Wahl seiner Überzeugungen, aber gleichzeitig auch die Anerkennung der gleichen Wahlfreiheit für die anderen.”[115] Nur eine Kirche, die zu ihren Überzeugungen steht, kann dem Wortsinn nach tolerant sein. Toleranz ist nur dort möglich, wo ich Überzeugungen habe und zu diesen stehe, andere Überzeugungen aber trotzdem akzeptiere und ihren Vertreterinnen und Vertretern mit Respekt, ja sogar mit Liebe begegne. Dort, wo alle Meinung gleich-gültig sein müssen, herrscht keine Toleranz, sondern Profillosigkeit. “Toleranz ist etwas anderes als Indifferenz. Das ist ein weitverbreitetes Missverständnis. Wem alles egal ist, der ist nicht tolerant, sondern gleichgültig. Toleranz bringt man gegenüber Überzeugungen und Handlungen auf, die man eigentlich ablehnt.”[116]
Die “Allein” in den hier formulierten Aussagen (A bis L) klingt in manchen Ohren intolerant, skandalös und anstößig. Aber: Das Verschweigen dieser “Allein” wäre geradezu lieblos, sofern sie eben die Realität sind. Gleichzeitig entlassen die “Allein” niemanden aus der Verpflichtung, mit Andersdenkenden liebevoll, respektvoll und tolerant umzugehen. Physischer oder geistiger Zwang widerspricht der Würde der Menschen, der Würde der christlichen Botschaft und dem Gebot der Liebe.
Die christliche Botschaft vermittelt uns die Faszination, selbst starke Überzeugungen zu haben, und auch die persönliche Reife und Kompetenz, Menschen mit anderen Überzeugungen mit Respekt, Achtung und Liebe zu begegnen. Ohne Toleranz, in der sich eigene Überzeugungen mit Respekt und Liebe gegenüber Andersdenkenden kombiniert, wird die Kirche entweder profillos – wo sie die eigenen Überzeugungen nicht mehr hochhält – oder totalitär – wo sie Respekt und Liebe für Andersdenkende verliert.
Aus den bisherigen Beobachtungen ergeben sich zwei Fazits:

Fazit 1: Die christliche Botschaft war von Anfang an auch skandalös
Wir haben gesehen: Die Predigten der Apostelgeschichte lassen sich in 10 Grundaussagen (1 bis 10) zusammenfassen, die 12 Konsequenzen (A bis L) beinhalten. Diese Aussagen sind einerseits voller Kraft und Schönheit. Gleichzeitig wirken diese Aussagen in ihrem Anspruch skandalös. Das war schon zur Zeit der Apostel nicht anders.
Die christliche Botschaft kann vieles sein, aber eines nicht: eine langweilige Harmlosigkeit. Man darf sich darüber freuen und man kann sich darüber aufregen, aber etwas sollte man keinesfalls tun: davon unberührt bleiben. Der christliche Glaube ist ein Abenteuer und ein Wagnis zwischen göttlicher Kraft und Schönheit sowie grenzenlosem Skandal.
C. S. Lewis deutet diese Spannung mit seiner Beschreibung des Löwen Aslan, einem Bild für Jesus, an: “Natürlich ist er nicht harmlos. Aber er ist gut. Ich sage euch doch, er ist der König.”[117] “So etwas Schreckliches und gleichzeitig Schönes hat keiner je gesehen.”[118] – Schön, kraftvoll, skandalös.
Mancherorts wurde und wird offenbar der Versuch unternommen, das Skandalöse des Glaubens im persönlichen Leben oder in der Verkündigung des Evangeliums auszublenden. Der Preis dafür war stets, dass auch die Schönheit, die Kraft und die Faszination des Glaubens verblassten. Aus einer gezähmten Botschaft wird schnell eine kraftlose, beliebige, austauschbare Botschaft. Wenn die Kirche Zukunft haben will, ist sie herausgefordert:
Lasst uns freudig und mutig zu den schönen, kraftvollen und zuweilen skandalösen Inhalten des Glaubens stehen.
Denn wie der Titel dieses Artikels sagt: Das Evangelium ist schön, kraftvoll und skandalös – oder nichts davon. Das war schon zur Zeit der Apostel so.
Eine Kirche, die ihre Botschaft, Überzeugungen und Werte zu stark der Gesellschaft anpasst, verliert ihr Profil, ihr Unterscheidungsmerkmal und schlussendlich ihre Relevanz und Bedeutung für die Gesellschaft.[119]
Mit Paulus erklären wir: “Andere mögen die christliche Botschaft als empörenden Skandal oder lächerlichen Wahnwitz ablehnen, wir erleben sie als dynamische Kraft und göttliche Weisheit.”[120]

Fazit 2: Das christliche Bekenntnis war von Anfang an weitgehend klar.
Wir haben gesehen: Die Predigten der Apostelgeschichte lassen sich in zehn Grundaussagen (1 bis 10) zusammenfassen, die weitestgehend mit den Aussagen des Apostolischen Glaubensbekenntnisses beziehungsweise den Inhalten der altkirchlichen “Glaubensregel” (regula fidei; 200 n.Chr.) übereinstimmen.
Wie eingangs erwähnt, analysierte ich die Predigten in der Apostelgeschichte, um dem urchristlichen Verständnis des Evangeliums auf die Spur zu kommen. Ich untersuchte, welche Grundaussagen in diesen Predigten jeweils gemacht wurden. Als ich das Resultat betrachtete, kam es mir fast vor, als ob Irenäus, Tertullian und weitere frühchristliche Autoren, deren Texte schlussendlich zum Apostolischen Glaubensbekenntnis führten, vor 1850 Jahren dasselbe taten. Das Apostolische Glaubensbekenntnis liest sich wie eine Zusammenfassung der Predigten der Apostelgeschichte.
Die einzige Aussage des Credos, die sich so nicht in der Apostelgeschichte des Lukas findet, ist: “empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria”. Diese Aussage findet sich jedoch im ersten Teil des lukanischen Doppelwerks in Lukas 1,26–35 (vgl. Mt 1,18–25). Immerhin wird in der Apostelgeschichte erwähnt, dass Jesu Mutter Maria hiess (Apg 1,14; vgl. Lk 1,27.34). Dass Jesus als “Gottes Sohn” verkündigt wurde (Apg 9,20), kann als Messias-[121] und Königstitel[122] verstanden werden. Gleichzeitig wird “Gottes Sohn” in Lukas 1,35 als Hinweis dafür verstanden, dass Jesus durch den Heiligen Geist empfangen wurde.
Dass sich umgekehrt die zahlreichen Verweise auf die Schrift in der Apostelgeschichte nicht im Glaubensbekenntnis finden, wurde bereits erwähnt. Irenäus sieht die “Glaubensregel” und die Schrift als zwei Zeugen des Evangeliums (vgl. F).
Die Einheit unter Gläubigen und unterschiedlichen Kirchen folgt seit jeher dem Leitsatz: “In den Kernfragen Einheit, in den Nicht-Kernfragen Freiheit, in allem Liebe”. Dabei hilft es, zu unterscheiden zwischen
(1.) Kernfragen christlicher “Rechtgläubigkeit”,
(2.) Kernfragen für die Einheit einer Kirche oder Denomination
(3.) Nicht-Kernfragen, bei denen wir in Einheit Freiheit leben
(Gewichtungs-Kategorien christlicher Lehren).
Bei den Grundaussagen der Predigten in der Apostelgeschichte beziehungsweise den Aussagen des Apostolischen Glaubensbekenntnisses geht es um Kernfragen des Evangeliums und der christlichen “Rechtgläubigkeit” (1.). Es sind die Inhalte des apostolischen, historischen Glaubens.
200 n.Chr. waren diese Aussagen die Grundlage dafür, ob man getauft wurde oder nicht, ob man “in” war oder “out”. Christ oder Christin zu sein, bedeutete eben nicht einfach, Jesus irgendwie positiv zu finden. Es bedeutete, die zentralen Aussagen des Evangeliums zu glauben, wobei das Wort “Evangelium” einen königlichen Erlass bezeichnet und das deutsche Wort “glauben” von “geloben” kommt, so wie das griechische “pistis” neben “Glaube” auch “Treue” bedeutet. Das Evangelium zu glauben bedeutet, einem königlichen Erlass Treue zu geloben.
Am 4. Lausanne-Kongress vom 22. bis 28. September 2024 wurde mehrmals betont: “Verfolgung wird die Gemeinde nicht umbringen, ein verfälschtes Evangelium schon.” (“Persecution never kills the church, but a compromised gospel will.”) In diesem Sinn tun wir gut daran, die Inhalte des apostolischen, historischen Glaubens zu den Kernfragen des Christseins zu zählen.

Tabellarische Übersicht
| Grundaussagen der Predigten in der Apostelgeschichte (Reihenfolge gemäss Apostolischem Glaubensbekenntnis) | Belegstellen (vor allem in Apg und Lk) | Aussagen des Apostolischen Glaubensbekenntnisses |
| 1. Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde, der Vater. | Apg 4,24; 14,15; 17,24–25; vgl. Lk 10,21 Apg 1,4; 1,7; 9,20; 17,28–29; vgl. Apg 13,26 | Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. |
| 2. Jesus ist König (Christus, Menschensohn) und richtet das Königreich Gottes auf. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist Herr. | Apg 2,36; 4,25–26; 7,56; 9,22; 10,35–36; 13,22–23; 17,7 Apg 8,12; 20,25; 28,31; vgl. Apg 10,38–39 Apg 9,20; vgl. Lk 1,35; Lk 4,3; Lk 9,20 Apg 2,36; 10,36; 20,21; 20,24; 20,35 | Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, |
| – | Lk 1,26–35; Mt 1,18–25; Apg 1,14; vgl. Apg 9,20 mit Lk 1,35 | empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, |
| 3. Jesus wurde gemäss Gottes Willen von der jüdischen Führung und Pilatus ans Kreuz gebracht. | Apg 2,23; 2,36; 3,13–15; 3,18; 4,10; 4,27–28; 5,30; 7,52; 10,39; 13,27–28; 26,22–23 | gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, |
| 5. Gott bestätigte Jesus durch die Auferweckung und Erhöhung in den Himmel sowie Wunder in seinem Namen als Christus (König). | Apg 2,27; 2,30; 2,32–33; 2,36; 3,13; 3,15; 5,30–31; 7,55–56; 10,40–41; 13,30; 17,3; vgl. Apg 1,9–11; Lk 22,69; Lk 24,6–7; Lk 24,34; Lk 24,46; Lk 24,51 Apg 3,6; 3,12; 3,16; 4,7; 4,10; 4,14; 4,16; 4,30; 8,6–7; 8,13; 14,3 | am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; |
| 6. Gott hat Jesus durch die Schrift als Christus (König) bestätigt. | Apg 2,16; 2,21; 2,25–31; 2,34–35; 2,36; 3,18; 3,22–26; 4,11; 8,31–35; 13,27; 8,32–37; 17,2–3; 17,11; 26,22–23 | – |
| 7.a Jesus wird als Christus (König) und Richter aller Menschen wiederkommen. | Apg 3,22–26; 10,42; 17,31; vgl. Lk 21,27 | von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. |
| 8. Gott hat Jesus durch die Ausgiessung des Heiligen Geistes als Christus (König) bestätigt. | Apg 2,33; 2,36; 5,31–32; vgl. Lk 4,18 | Ich glaube an den Heiligen Geist, |
| 9. Jesus erwarb die Gemeinde durch sein Blut. | Apg 20,28; vgl. Apg 2,41–47; 4,32; 8,32–35; Ps 74,2; Ex 15,16; Lk 22,29–30 | die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, |
| 4. Jesus schenkt Vergebung der Sünden. | Apg 2,38; 3,19; 5,31; 8,32–35; 10,43; 13,38a; 20,32; 26,18; vgl. Apg 2,40; 4,12; 13,38b-39; 14,3.7; 20,24; Lk 5,20; 23,34 | Vergebung der Sünden, |
| 7.b Jesus wird eine Segenszeit für alle Völker bringen. | Apg 3,20–21; Apg 3,25; Apg 24,15; vgl. Apg 13,48; Lk 18,30; Lk 20,35–36 | Auferstehung der Toten und das ewige Leben. |
| 10. Die Menschen sollen an Jesus glauben (den Namen Jesu anrufen), sich von ihrer Bosheit abkehren (Busse tun) und sich taufen lassen. | Apg 8,12; 10,43; 17,31; vgl. Apg 2,21; Apg 8,5; Apg 8,12; Apg 9,28; Apg 22,16; Röm 10,9–10 Apg 2,38; 3,19; 3,26; 5,31; 17,30; 20,21; 26,28 Apg 2,38; 8,12; 8,36–38; 10,47–48; 22,16 | Ich glaube (Das Apostolische Glaubensbekenntnis war ursprünglich ein Taufbekenntnis.) |
Bilder:
iStock
Fussnoten:
[1] Apostelkonzil, Apg 15,1–30.
[2] Apg 5,42; 8,25; 8,35; 11,20; 14,7; 14,15; 14,21; 16,10; 17,18; 20,24; 2Kor 9,13.
[3] Apg 4,24; 14,15; 17,24–25; vgl. Lk 10,21.
[4] Apg 1,4; 1,7; 9,20; 17,28–29 vgl. Apg 13,26.
[5] Mt 6,9; Röm 1,25.
[6] 1Mo 17,1; Ps 95,3.
[7] Röm 9,20.
[8] 1Mo 18,25; Hebr 12,23; Röm 12,19.
[9] Mt 6,9; 1Joh 4,8.
[10] Jes 51,12.
[11] Hebr 13,6.
[12] Ps 139.
[13] Es ist anzuerkennen, dass es eine kleine Minderheit mit nicht eindeutigen körperlichen Geschlechtsmerkmalen gibt.
[14] Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der “gefallenen Schöpfung”, deren Teil wir Menschen sind.
[15] Gal 5,22–23; 1Kor 12,4–31.
[16] “Ihre wirkungsmächtigste Formulierung hat die Glaubensregel im Apostolischen Glaubensbekenntnis – auch Apostolicum oder Credo genannt – erhalten.“Luca Baschera und Frank Mathwig: Die Kirche in der Präambel: Die Verfassungspräambel der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz EKS aus theologischer Sicht. 2020, 10–11. https://www.evref.ch/publikationen/die-kirche-in-der-praeambel/; aufgerufen 06.01.2021.
[17] Irenäus formuliert in seinem Werk Gegen die Häresien (Irrlehren) bereits zirka 180 n.Chr., was ein “rechtgläubiger” Christ grundsätzlich glaubt. Irenäus nennt dies die “Apostolische Tradition” (1.10.1; 2.9.1; 3.1.2; 3.3.3; 3.4.2), die “Lehre der Apostel” (3.1.1; 3.15.1), die “Richtschnur der Wahrheit” (1.22.1; 3.15.1) beziehungsweise die “Richtschnur des Glaubens” (regula fidei; 1.22.1), die er detailliert auflistet (1.10.1.). In ähnlichen Worten beschreibt auch Tertullian zirka 204 n.Chr. in seinem Werk Prozesseinreden gegen die Häretiker die “Richtschnur des Glaubens” (Kp 13). Diese “Richtschnur des Glaubens” umfasst so gut wie alle Inhalte des späteren Apostolischen Glaubensbekenntnisses.
[18] “Alsdann steige er ins Wasser, der Priester aber lege die Hand auf seinen Kopf und frage ihn mit folgenden Worten: ‘Glaubst du an Gott, den allmächtigen Vater?’ Und indem der Täufling erwidert: ‘Ich glaube,’ wird er zum ersten Mal ins Wasser getaucht, während der Priester seine auf den Kopf gelegte Hand zurückzieht. Zum zweiten Male fragt er ihn mit folgenden Worten: ‘Glaubst du an Jesus Christus, den Sohn Gottes, den die Jungfrau Maria vom heiligen Geiste geboren hat, der gekommen ist, das Menschengeschlecht zu erlösen, der gekreuzigt ist für uns zur Zeit des Pontius Pilatus, der gestorben ist und auferstanden von den Todten am dritten Tage und aufgefahren ist in den Himmel und sitzet zur Rechten des Vaters und kommen wird zu richten die Lebendigen und die Todten?’ Indem er antwortet: ‘Ich glaube,’ wird er zum zweiten Male in das Wasser getaucht. Zum dritten Male wird er gefragt: ‘Glaubst du an den heiligen Geist, den Tröster, der von dem Vater und dem Sohne ausgeht?“ Indem er antwortet: ‘Ich glaube,’ wird er zum dritten Mal in das Wasser getaucht. Bei jeder Eintauchung sagt der Taufende: ‘Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes, der gleich ist (dem Vater und dem Sohne).’ ” Canones 19, 11. Zur Verfasserschaft: https://bkv.unifr.ch/de/works/cpg-1742/versions/einleitung-canones-hippolyti/divisions/2
[19] 1Joh 4,8, 1Joh 4,16; Joh 3,16.
[20] Klaus Douglass: Gottes Liebe feiern: Aufbruch zum neuen Gottesdienst, 2003, 178.
[21] Joh 16,27; 1Joh 2,15; 3,1; Röm 8,15; Gal 4,6; Eph 6,23; 2Thes 2,16; Jud 1.
[22] Apg 2,36; 4,25–26; 7,56; 9,22; 10,35–36; 13,22–23; 17,7.
[23] Apg 8,12; 20,25; 28,31; vgl. Apg 10,38–39.
[24] Apg 9,20; vgl. Lk 1,35; Lk 4,3; Lk 9,20.
[25] Apg 2,36; 10,36; 20,21; 20,24; 20,35.
[26] Mt 11,5–6 vgl. Jes 35,5–6 und 61,1; Mt 12,28; Luk 4,18–19 vgl. Jes 61,1–2; Lk 9,11; Lk 10,9; Lk 11,20; Lk 16,16; Lk 17,20–21; Röm 14,17; 1Kor 4,19–20; Kol 1,13–14.
[27] Röm 10,12; Apg 17,7; Phil 2,9–11; Ps 2,7–8; 72,1.8; 89,19–20.26–27.
[28] Apg 17,7; 1Joh 4,2; 1Tim 6,15; Off 17,14; 19,16; N. T. Wright: Worum es Paulus wirklich ging, 2010, S. 193.
[29] Apg 10,38–39.
[30] Kol 1,15–17; 1Kor 15,1–20.
[31] Apg 2,23; 2,36; 3,13–15.18; 4,10; 4,27–28; 5,30; 7,52; 10,39; 13,27–28; 26,22–23.
[32] Apg 2,38; 3,19; 5,31; 8,32–35; 10,43; 13,38a; 20,32; 26,18; vgl. Apg 2,40; 4,12; 13,38b-39; 14,3.7; 20,24; Lk 5,20; Lk 23,34.
[33] Jesus starb zur Sühnung der Sünde: 1Kor 15,3; 2Kor 5,21; Gal 1,4; 1Pet 3,18; 1Joh 4,10; Hebr 2,17. Durch sein Blut schaffte er Vergebung: Mt 26,28; Röm 5,9; Eph 1,7; Hebr 9,22; 10,29; 1Petr 1,18–19; 1Joh 1,7; Off 1,5; 7,14. Durch sein Blut schaffte er Versöhnung: Röm 5,8–11; Kol 1,20; Eph 2,13.16; Hebr 13,20; vgl. Apg 20,28.
[34] Vgl. Joh 3,16. Das Kreuz als Symbol des ewigen Lebens steht im Zusammenhang mit seiner Auferstehung und dem leeren Grab.
[35] 2Kor 5,20–21; Joh 14,6; Timothy Keller: “The gospel is an exclusive truth but it’s the most inclusive exclusive truth in the world.”
[36] Joh 16,8–11; 1Kor 12,3.
[37] 1Kor 1,18; 1,23–24; Phil 2,8; Hebr 12,2.
[38] Apg 8,25; 11,19–20; 13,48; 15,35–36; 16,32; 19,10.
[39] 1Kor 1,18; 1,23–24.
[40] Apg 2,27; 2,30; 2,32–33; 2,36; 3,13; 3,15; 5,30–31; 7,55–56; 10,40–41; 13,30; 17,3; vgl. Apg 1,9–11; Lk 22,69; Lk 24,6–7; Lk 24,34; Lk 24,46; Lk 24,51.
[41] Apg 3,6; 3,12; 3,16; 4,7; 4,10; 4,14; 4,16; 4,30; 8,6–7; 8,13; 14,3.
[42] Apg 1,22; 2,24; 2,31–32; 3,15; 4,2; 4,33; 5,30–32; 10,39–41; 13,30–31; 22,14–15; 26,16; 26,21; vgl. 1Kor 15,5–9.
[43] Apg 17,3; 17,31; Röm 1,4.
[44] Apg 17,18; vgl. 1Kor 15,1–24.
[45] Apg 2,33; 2,36; 5,31–32; vgl. Lk 4,18; Joh 16,7–11.
[46] Christian Haslebacher, Dein Leben zählt, 2025, 108. (www.dynamic.faith).
[47] Phil 2,8–11; Hebr 12,2; vgl. Lk 9,28–35 mit 21,27 und Apg 1,9.
[48] Apg 26,23; 1Kor 15,20–24; Kol 1,18; Off 1,5–6.
[49] Joh 3,15–16; 3,36; 6,40; 6,54.
[50] Apg 17,3; 17,31; Röm 1,4.
[51] Röm 8,31–34; 1Joh 2,1; Hebr 9,24–25.
[52] 1Kor 15,14; 15,17; 15,19.
[53] Apg 17,18; 17,32; 1Kor 15,12–13; Mt 22,23–29.
[54] Apg 2,16–21; 2,25–31; 2,34–35; 2,36; 3,18; 3,22–26; 4,11; 8,31–35; 13,27; 13,32–37; 17,2–3; 17,11; 26,22–23.
[55] Joh 10,34–35; Mk 7,13.
[56] 2Tim 3,16–17; 2Petr 1,20–21.
[57] Joh 2,11; 2,23; 4,48; 6,26; 6,30; 7,31; 12,37.
[58] Joh 20,29–31; Röm 10,17; 1Kor 15,14; 2Tim 3,16.
[59] Im Bekenntnistext, der in 1Kor 15,3–5 aufgenommen wurde, wird zweimal auf die Schrift verwiesen, ebenso im Nicäno-Konstantinopolitanum 451 n.Chr.: “ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift”.
[60] 3.2.1 und 3.2.2; “Canon confirms creed, and creed confirms canon.” Robert W. Jenson, Canon and Creed, 2010, Kindle-Position 427.
[61] Apg 3,22–26; 10,42; 17,31; vgl. Lk 21,27.
[62] Off 10,7; 11,15; 1Kor 15,51–52; Mt 6,10.
[63] 2Kor 2,14–15; 4,6–7; Mt 5,13–16.
[64] Christian Haslebacher, Dein Leben zählt, 2025, 56. (www.dynamic.faith).
[65] Apg 2,33; 2,36; 5,31–32; vgl. Lk 4,18.
[66] 1Kor 12,3; Röm 8,9; vgl. Eph 2,8.
[67] Röm 5,5.
[68] Röm 8,14–16.
[69] Vgl. Joh 6,44; 15,26; 20,16–17, Apg 22,6–9; 2Kor 12,9.
[70] Jak 2,14–26.
[71] Joh 13,35; 15,12; Röm 12,10; 1Thes 3,12; 4,9.
[72] “Nur um deutlich zu machen, was gemeint ist, und im Wissen um die Belastung des Begriffs ‘Mystik’ (der recht verstanden, kein Gegensatz zu einem Glauben im Heiligen Pneuma [Geist] ist, sondern dasselbe) könnte man sagen: Der Fromme von morgen wir ein ‘Mystiker’ sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein, weil die Frömmigkeit von morgen nicht mehr durch die […] einstimmige, selbstverständliche öffentliche Überzeugung und religiöse Sitter aller mitgetragen wird”. Karl Rahner, Frömmigkeit früher und heute, 1966
[73] Johannes Hartl: Vortrag “Folge der Wolke”, MEHR Konferenz 2020.
[74] Vgl. Joh 20,21–22; Apg 1,8.
[75] Alexander Garth: Gottloser Westen? Chancen für Galuben und Kirche in einer entchristlichten Welt, 2017, 1.
[76] Vgl. Apg 1,8; Eph 5,18; vgl. Petrus in Apg 2,4; Apg 4,8; Apg 4,31.
[77] Nach Röm 15,18–19; Apg 1,8; 2Kor 5,20; Mt 5,13–16; 28,18–20.
[78] “Lasst uns aufhören zu glänzen und anfangen zu leuchten”, Credo von gute-botschafter.de/philosophie
Vgl. 2Kor 4,6–7; 1Joh 1,5; Kol 1,27; Mt 5,14–16; Lk 11,33–36.
[79] Apg 20,28; vgl. Apg 2,41–47; 4,32; 8,32–35; Ps 74,2; Ex 15,16; Lk 22,29–30.
[80] 1Kor 3,16, Eph 2,22.
[81] 1Kor 12,27; Eph 4,12.
[82] Mt 5,14; vgl. Joh 8,12.
[83] 2Kor 5,17; Eph 1,14; vgl. Joh 8,12; 9,5 mit Mt 5,14–16; vgl. Lk 10,16; Joh 14,12.
[84] Hebr 10,19; 10,22–25.
[85] https://danieloption.ch/ethik/kirche-als-raum-der-gnade‑1–3/
https://danieloption.ch/ethik/kirche-als-raum-der-gnade‑2–3‑neun-thesen/
https://danieloption.ch/ethik/kirche-als-raum-der-gnade‑3–3‑der-3ab-weg/
[86] 1Kor 12,13; Gal 3,28.
[87] Apg 2,41–42; 2,47; 12,5; 13,1; 14,23; 14,27; 15,3–4; 15,22; 15,30; 15,41; 16,5; 20,2; 20,28.
[88] https://danieloption.ch/gesellschaft/ehe-fuer-alle/bekenntnis/
[89] 2Mo 20,2–17; Eph 5,1–18; 1Petr 1,14–16; Röm 12,1–2.
[90] Kol 3,3–6; Röm 13,13–14; Eph 4,20–32.
[91] 1Kor 3,16–17; 6,18–19.
[92] 1Kor 5,1–13; Eph 4,11–32.
[93] Adolf Schlatter: Christliche Ethik, 1914, 29ff.
[94] Helmut Burkhardt: Einführung in die Ethik: Grund und Norm sittlichen Handelns, 1996, 25.
[95] Vgl. Off 4,8.
[96] Apg 9,13–14; 9,31–32; 9,41; 26,10; vgl. 1Kor 1,2; 2Kor 1,1.
[97] Eph 5,3; Kol 3,5; 1Thes 1,3; 2Tim 2,21–22; 1Petr 1,14–16.
[98] 1Kor 3,17.
[99] Apg 15,20; 15,29; 21,25; vgl. 3Mo 17 und 18
[100] 1Kor 8
[101] Heinzpeter Hempelmann, Nicht auf der Schrift, sondern unter ihr, 2004, 67–68.
[102] Apg 8,12; 10,43; 17,31; vgl. Apg 2,21; 8,5; 8,12; 9,28; 22,16; Röm 10,9–10.
[103] Apg 2,38; 3,19; 3,26; 5,31; 17,30; 20,21; 26,28.
[104] Apg 2,38; 8,12; 8,36–38; 10,47–48; 22,16.
[105] Joh 20,16–17; Apg 22,6–9.
[106] Vgl. Gilbert Keith Chesterton: Orthodoxie, 6. Kapitel.
[107] 1Joh 4,8; 4,16.
[108] Vgl. Mt 13,58; 22,14; 22,37–38; 23,37; Mk 6,5; Joh 3,19; 12,48; Apg 7,51; Hebr 3,7–8; 3,15; 4,7; Jer 20,7.
[109] Vgl. Jak 2,19.
[110] Matthias Zeindler, Erwählung: Gottes Weg in der Welt, 2009, 131.
“Nicht der Mensch stellt die Frage und Gott gibt darauf die Antwort. Sondern Gott stellt dem Menschen seine Frage – und der Mensch hat den Auftrag, mit seinem Leben darauf Antwort zu geben.” (S. 24) “Das Ja des Menschen zu Gott ist der Spiegel von Gottes Ja zum Menschen. Nachdem dies gesagt ist, bleibt nun allerdings ein Rätsel: das schaurige Rätsel des Nein des von Gott gerufenen Menschen. […] Das Rätsel dieses Nein besteht darin, dass der befreiende Ruf zwar ergeht, der Gerufene aber die Freiheit ausschlägt; dass ihm der Reichtum des Lebens aus Gott zwar vor Augengestellt wird, der Angesprochene aber die Armut der gottfernen Existenz wählt.” (188)
[111] Joh 20,16–17; Apg 22,6–9.
[112] Siegfried Kettling, Typisch evangelisch: Grundbegriffe des Glaubens, 1993, 138–139.
Vgl. Peter Brunner, Die Freiheit des Menschen in Gottes Heilsgeschichte, in: Peter Brunner, Pro Ecclesia, 1962, 108–125. Matthias Zeindler, Erwählung: Gottes Weg in der Welt, 2009, 123–124. Helmut Burkhardt, Spiritualität und Umkehr, 413, in: P. Zimmerling (Hrsg.), Handbuch evangelische Spiritualität, 2018, 416–417. Gerhard Friedrich, Glaube und Verkündigung bei Paulus, 112, in: Ferdinand Hahn und Hans Klein (Hrsg.), Glaube im Neuen Testament: Studien zu Ehren von Hermann Binder anlässlich seines 70. Geburtstags, 1982, 93–113.
[113] 1Mo 2,19–20; 22,1; 22,12; 2Mo 4,8–9; Jer 26,3.
[114] https://danieloption.ch/glaube/toleranz/
[115] “Erklärung von Prinzipien der Toleranz”, 28. Generalkonferenz von den Mitgliedstaaten der UNESCO, 1995.
[116] Philosoph und Politikwissenschaftler Rainer Forst, Professor an der Johan Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main, im Magazin “brand eins”, Heft 02, Februar 2020, Artikel ” Wir schulden einander vernünftige Gründe”, 56–59, hier 57.
[117] Der König von Narnia.
[118] Der Ritt nach Narnia.
[119] Jürg Stolz: “Ist Gott ein Auslaufmodell? “; www.beobacher.ch.
[120] Nach 1Kor 1,18; 1,23–24, Röm 1,16.
[121] Lk 4,41; Joh 20,31.
[122] Joh 1,49.





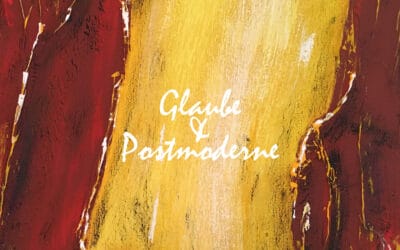
Vielen Dank für diese kompakte Zusammenstellung christlicher Grundüberzeugungen!
Mir stellt sich noch die Frage, ob wir das Apostolikum als notwendiges Credo oder auch als hinreichendes ansehen. Verschiedene Zeiten in der Kirchengeschichte hatten verschiedene Herausforderungen und verlangten dann auch neue Themen in Bekenntnissen, die vorher so nicht drankamen (z.B. was du über die Schrift schreibst, ist nicht explizit Teil des Apostolikums, hätte heute aber wohl Bekenntnis-Status).