ESSAYS ZU GLAUBEN UND POSTMODERNE 4/5
Die Postmoderne bietet zahllose Optionen, die uns rastlos machen und trimmt uns auf Effizienz. In den ersten drei Essays habe ich mich hauptsächlich mit der postmodernen Toleranz und dem Wahrheitsbegriff befasst und mich denkerisch damit auseinandergesetzt. In diesem Essay frage ich nach Spiritualität und spreche für einmal das Herz an. Ich bringe zwei Welten zusammen: Ich frage mich, was geschieht, wenn der berühmte Psalm 23 aus die Postmoderne trifft.
Die 150 Psalmen, die uns in fünf Sammlungen überliefert sind, gehören zu den beliebtesten Teilen der Bibel. Im Grunde genommen sind die Psalmen das Liedbuch Israels ohne Noten (unser heutiges Notationssystem entstand erst im späten Mittelalter). Was wie ein Verlust klingt, ist ein Segen. Es inspiriert uns, die alten Texte mit neuen Melodien zu versehen. Die Psalmen sind eine Quelle lebendiger Spiritualität, die seit Jahrtausenden munter sprudelt.
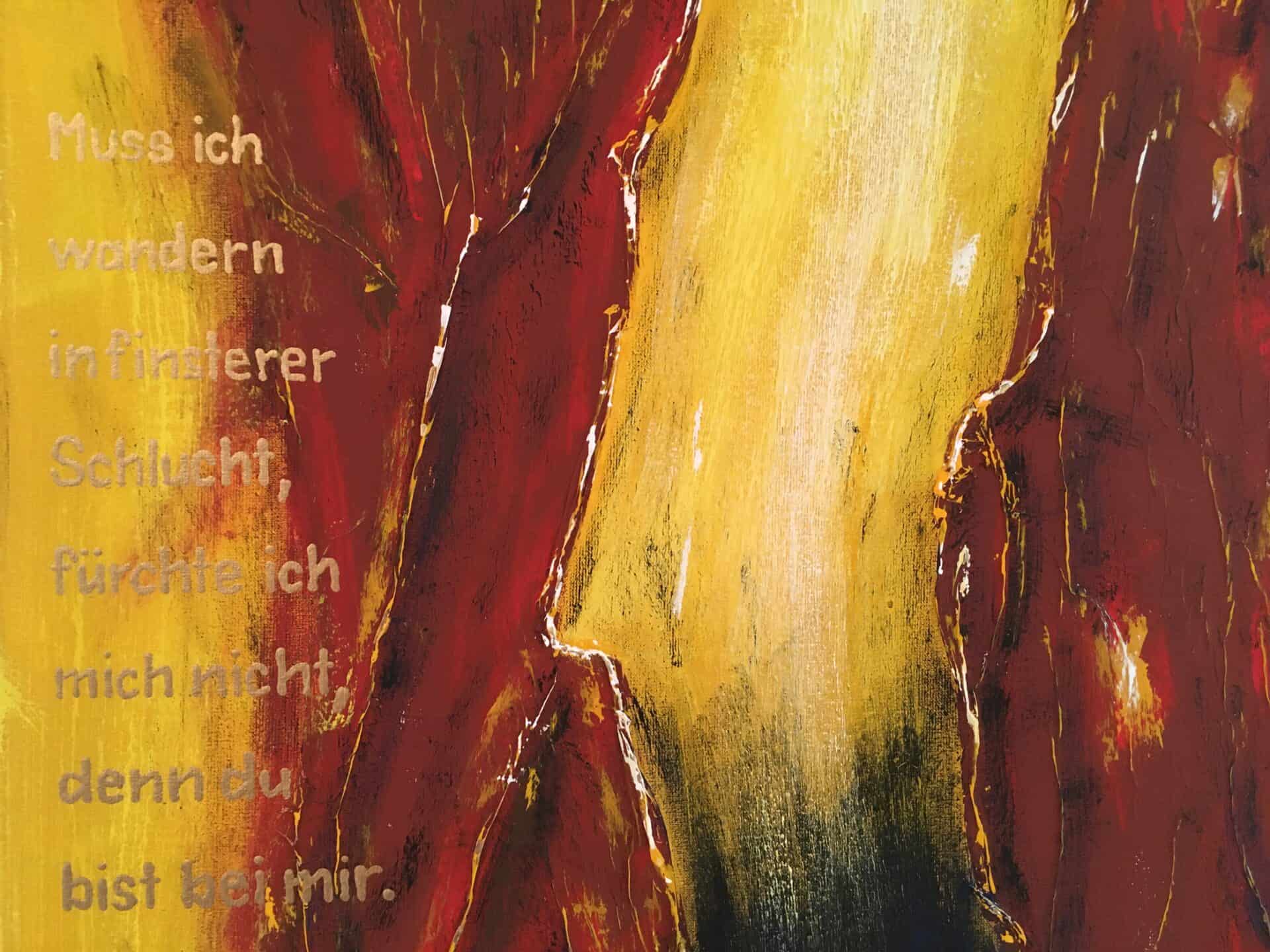
Bild: Roland Hardmeier
Cover-Versionen
Das berühmte «Yesterday» der Beatles gilt mit 1600 Cover-Versionen als den meistnachgespielten Song der Musikgeschichte. Das ist ziemlich sicher falsch. Von Psalm 23 dürfte es 10’000 oder mehr sein. Ob in einem Gottesdienst in Berlin, einer Hauskirche im 18. Stockwerk eines Wolkenkratzers in Shanghai oder unter einem Affenbrotbaum in Kenia, wo Christen sich zum Gottesdienst versammeln. Überall entstehen laufend neue Versionen von Davids berühmtem Psalm.
Wie passt ein Lied, das vor dreitausend Jahren in einer uns völlig fremden Welt entstand in die Postmoderne?
Vielleicht ist es der Gegensatz zwischen beiden Welten, welcher der Psalm seine ewige Jugend verdankt. Wenn der Psalm 23 auf die Postmoderne trifft, entstehen faszinierende Gegensätze:
Der Philosoph Hartmut Rosa legt in seinem Essay «Unverfügbarkeit» dar, dass die Welt für uns zum Aggressionspunkt geworden ist.[1] Alles muss beherrscht und nutzbar gemacht werden: Gewicht muss reduziert, Berge müssen bestiegen, die Anzahl Schritte pro Tag gesteigert werden. Immer mehr, immer weiter, immer schneller. Diese aggressive Lebenseinstellung macht uns rastlos. In Psalm 23 trifft Aggression auf Gelassenheit:
«Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre» (Psalm 23,1–3).
Das Wissen, dass Gott weidet, führt, leitet macht gelassen. Was wir haben und was wir nicht haben, ist vom Allmächtigen abgemessen.
Das Antriebsmoment unserer Kultur ist nach Rosa das Begehren, uns die Welt verfügbar zu machen. Vom Fliessband in der Fabrik bis zu Fettablagerungen in unserem Körper wird alles optimiert. Happy Birthday wird zu Happy Botox. Was verheissungsvoll klingt, wird zur Bedrohung, wie Rosa klug feststellt. Wir fürchten, das Leben könnte uns entgleiten, wenn wir es nicht schaffen, effizienter zu werden.[2]
Vertrauen statt Verfügbarkeit
Der biblische Gegenentwurf zum Wahn der Verfügbarkeit ist schlichtes Vertrauen. David fasst es in seinem berühmten Psalm in symbolträchtige Sprache:
«Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand» (Psalm 23,4–5).
David weiss, dass Gott mit ihm ist, wenn es durch dunkle Täler geht. Er flickt nicht am Universum herum. Er vertraut, dass Gott ihm voll einschenkt. David berührt mit diesem Text das Geheimnis der Vorsehung. Wenn wir durch Leiden gehen, brauchen wir nichts so sehr wie schlichtes Vertrauen auf den Allmächtigen. Es wächst dort am besten, wo der Glaube an die göttliche Vorsehung fest verankert ist. Dieser Glaube führt nicht dazu, dass man rastlos nach Glück strebt, das einem doch zusteht, sondern dass man im Vertrauen auf Gottes Weg «Ja» zu seiner Lebenssituation sagen kann. Christen wissen, dass das eine weithin unbeachtete Form von Glück ist. Überhaupt ist Glück nicht etwas, dass Christen um alles in der Welt erstreben. Sie erleben Glück sozusagen als Nebenprodukt der Nachfolge. Jesus drückt es im Stil der alttestamentlichen Weisheit so aus: «Wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen» (Matthäus 16,25).
Begegnung mit dem Unverfügbaren
Hartmut Rosa schreibt in seinem Essay, dass Lebendigkeit, Berührung und wirkliche Erfahrung aus der Begegnung mit dem Unverfügbaren entstehen. Jede Zeile von Davids Psalm sagt genau dies aus. Gott ist nicht verfügbar, aber erfahrbar. Er sorgt für uns wie ein Hirte. Er beschenkt uns wie ein Gastgeber. Er ist der ewig Gegenwärtige.
Über Gott zu verfügen, ist die Weigerung, die unverständlichen Seiten Gottes auszuhalten. David erklärt Gott nicht, er beschreibt, was Gott tut und vertraut, dass er auch in den dunklen Tälern wirkt.
Der Psalm 23 entwickelt eine erstaunliche meditative Kraft. Wenn man ihn betet, breitet sich Gelassenheit aus, sofern man sich ausreichend Zeit nimmt, um die Worte wirken zu lassen. Im Judentum kennt man das murmelnde Nachsinnen über Gottes Wort. Ein Psalm oder sonst ein Text wird leise vor sich hingesprochen. Das Mönchtum entwickelte diesen Zugang zur «lectio divina» (göttlichen Lesung) weiter, bei der ein Bibeltext betend gelesen wird. Man erfasst den Text mit dem Herzen und wird von seiner Wahrheit tief geprägt. Das Vertrauen auf Gottes Vorsehung und seine gute Führung ist das Ende der Rastlosigkeit.
[1] Rosa, Hartmut 2022. Unverfügbarkeit, 12ff.
[2] Ebd., 15.

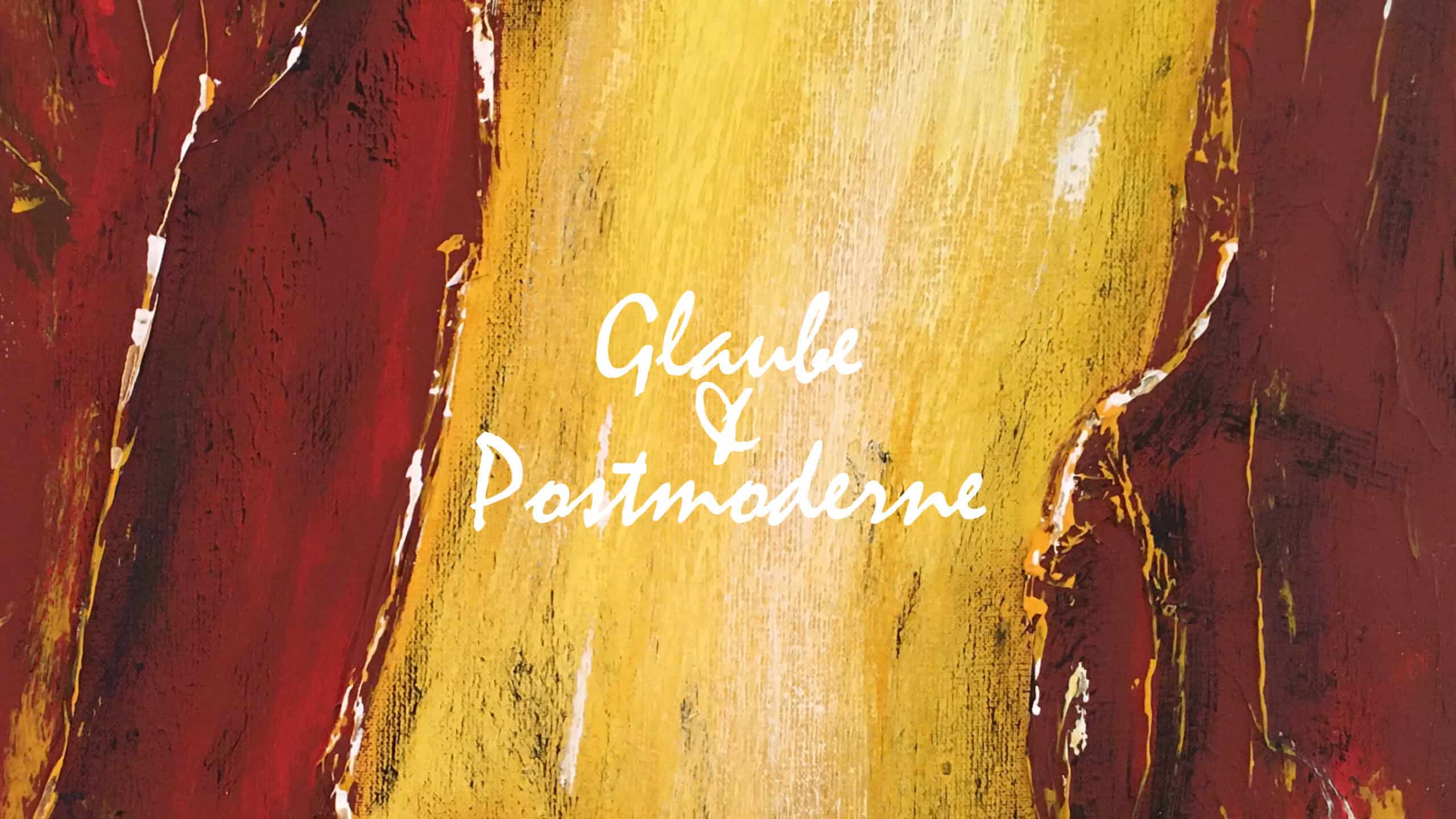


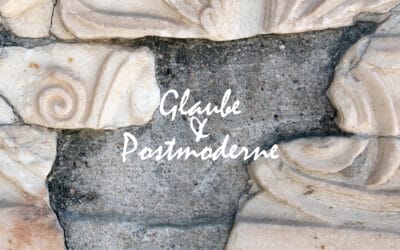
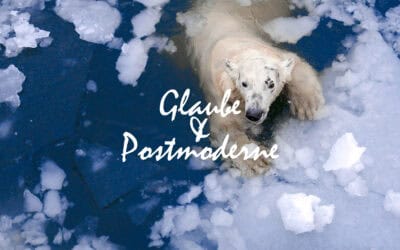
Genauso ist es.