ESSAYS ZU GLAUBEN UND POSTMODERNE 5/5
Die ersten Christen lebten in einer Welt, die der Postmoderne erstaunlich ähnlich ist. Die antike Welt war mit wenigen Ausnahmen pluralistisch. Gleichzeitig gab es einen starken Druck von der Mehrheitskultur. Und es gab Konkurrenz von der antiken Philosophie. Trotzdem setzte sich das Christentum durch. Woher rührte dieser Erfolg? Was hatte das Christentum, was antike Philosophie und Religion nicht bieten konnten?
Ulrich Victor nennt vier Vorzüge, welche das Christentum der Anfänge attraktiv machen:[1]
Einen strikten Monotheismus.
Einen allmächtigen Schöpfer.
Eine klare Theologie.
Die Kirche.
Klare Glaubensbestände
Wenn man nach den religiösen und gesellschaftlichen Verhältnissen der Antike fragt, ergibt sich folgendes Bild:
Der Monotheismus gewinnt unter den Griechen schon in vorchristlicher Zeit an Anziehungskraft. Er mausert sich um die Zeitenwende zu einer valablen Alternative zum antiken Polytheismus. Vor allem bietet das Christentum eine durchdachte Vorstellung von Gott. Gott ist der allmächtige Schöpfer, der den Kosmos in seiner Güte lenkt und keinem von uns fern ist (Apostelgeschichte 17,27). Die Philosophie dagegen ist ein Herumstochern im Nebel des Schicksals. Ihre Vordenker sind sich in so manchem uneins. Die Anhänger Platons und die Schule Epikurs bestreiten, dass die Welt durch göttliche Vorsehung gelenkt wird. Die Stoiker behaupten das Gegenteil und gehen von göttlicher Vorsehung aus. Das Christentum mit seinen klaren Glaubensbeständen hinsichtlich Gott, der Welt und den letzten Dingen bietet eine klare Theologie und damit Orientierung. Die antike Religion dagegen ist eine Religion ohne Theologie und ohne Kodifizierung.[2]
Philosophie und Religion haben in der Antike zwei unterschiedliche Aufgaben. Die Philosophie will zum Guten anleiten, damit der Mensch das Leben meistern kann. Religion dient der formellen Lebenserhaltung. Sie ist ein blosses Ritual. Griechen und Römer wissen nicht, warum sie den Göttern opfern. Sie tun es, weil man es schon immer getan hat. Man glaubt, das Gemeinwohl zu sichern, wenn man den Pfad der Väter nicht verlässt. Klingt nicht sehr überzeugend. Tatsächlich läuft die christliche Botschaft mit ihrer intellektuellen Anschlussfähigkeit der antiken Weltanschauung mit der Zeit den Rang ab.
Das Christentum ist nach antikem Verständnis beides: Philosophie und Religion. Es bietet Strategien zur Lebensbewältigung (wie die Philosophie) und Rituale, die dem Leben ein Ordnungsgefüge verleihen (wie die antike Religion). In den ersten Jahrhunderten wird das Christentum daher oft als «philososophia» oder «sophia» bezeichnet. Nach Ulrich Victor überdauert das Christentum antike Philosophie und Religion, weil es beide Aufgaben viel überzeugender und entschiedener erfüllt.
Revolutionäre Kirche
Schliesslich bringt das Christentum die Kirche hervor. Ein Christ ist nach neutestamentlichem Verständnis Angehöriger einer lokalen Kirche oder er ist keiner. Im Gegensatz zu heute ist die Kirche nicht das Problem, sondern die Lösung. Wahrscheinlich geht man nicht falsch, wenn man sagt: Die Art und Weise, wie Christen in der Antike Kirche sind, ist das, was das römische Reich auf den Kopf gestellt hat. Was macht die «ekklesia», wie sie im Neuen Testament bezeichnet wird, so revolutionär?
Die Kirche ist eine Gemeinschaft der Gleichen und damit eine Gegenkultur zur sozialen Schichtung der Antike. Die Antike ist eine Gesellschaft der Ungleichen. Selig sind die Starken, denn sie werden sich durchsetzen. In Platons Dialogen sagt einer der Proponenten: «Die Natur selbst aber, denke ich, würde wohl zeigen, dass es gerecht ist, dass der Stärkere mehr habe als der Schwächere, und der Tüchtigere mehr als der Untüchtige». Weil die Natur das Schicksal so bestellt, ist es gerecht, «dass der Stärkere über den Schwächeren herrsche und mehr habe.»[3] Dieses Denken ist in der Antike weit verbreitet.
Von der antiken Ungleichheit sind hauptsächlich Sklaven und Frauen betroffen. Aristoteles vertritt in seinem Werk «Politik» die Auffassung, manche Menschen seien von Natur aus eben Sklaven. Und er setzt noch einen obendrauf: Der Mann verdiene Vorrang vor der Frau, weil er eine höhere Intelligenz habe.[4] Mit ihrem Filibustern über die Natur des Menschen und das kosmische Schicksal zementieren die Philosophen die Ungleichheit der antiken Gesellschaft. Sie treten die Schwachen rhetorisch in den Staub, wo sie für alle Ewigkeit bleiben sollen und feiern die Starken. Tom Holland bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: «Die Rolle der griechischen Philosophen erschöpfte sich darin, dieses Selbstbild mit Goldrand zu versehen.»[5]
Die Christen heben die Verlierer aus dem Staub und nehmen sie in ihren Reihen auf. Anfangs schütteln Griechen und Römer bloss den Kopf. Doch dann beginnt sich im Grundgefüge der Gesellschaft etwas zu verändern: In der Kirche bröckelt der Zement der Ungleichheit. Es entsteht eine neue Möglichkeit menschlicher Beziehungen. Man versteht sich als Himmels-Familie, die auf Erden gesellschaftliche Schranken überwindet. Männer und Frauen begegnen sich auf Augenhöhe. Freie und Sklaven sind Brüder in Christus. Die Kirche bietet gar soziale Aufstiegsmöglichkeiten. Ein Ungebildeter kann Ältester einer Gemeinde oder Bischof werden.
Antike Vereine und die Kirche
Im Prinzip funktionieren die christlichen Hausgemeinden wie antike Vereine. «Collegia», wie die Römer sie nennen, gibt es wie Sand am Meer. Es sind Berufsvereine, wie die der Feuerwehrleute, religiöse Vereine, die sich der Verehrung einer bestimmten Gottheit verpflichten, Vereine, die den Mitgliedern ein anständiges Begräbnis ermöglichen oder Vereine mit ethnischer Prägung. Die Mitglieder treffen sich zum gemeinsamen Essen, unterstellen sich den Vereinsregeln und verpflichten sich zur gegenseitigen Unterstützung.
Die christlichen Hausgemeinden tun dasselbe, aber sie tun es besser: Von gewissen antiken Vereinen sind Frauen ausgeschlossen. In den christlichen Hausgemeinden sind sie vollwertige Mitglieder mit Rederechten und der Möglichkeit, Ämter wie das der Diakonin zu übernehmen oder einer Hausgemeinde als Patron vorzustehen. Die meisten Vereine kennen strenge Aufnahmebedingungen, die christlichen Hausgemeinen sind offen für alle.
Der revolutionärste Unterschied zwischen dem antiken Vereinsweisen und den christlichen Hausgemeinden betrifft das Verhältnis zu den Nicht-Mitgliedern. Antike Vereine orientieren sich am Ideal der Freundschaft unter den Mitgliedern. Das Ideal der christlichen Hausgemeinden ist die Agape-Liebe, die über die Gemeinschaft hinaus allen Menschen gilt, insbesondere Bedürftigen.
Die christlichen Hausgemeinden sind die einzigen Vereine, die zum Wohl der Nicht-Mitglieder existieren. Später schreibt der Kirchenvater Tertullian in seiner Verteidigung des christlichen Glaubens, die Christen würden treu für den Kaiser beten, Geld zusammenlegen für die Begräbnisse von Armen und elternlosen Kindern, sie würden für Schiffbrüchige sorgen und ihre Geschwister im Gefängnis besuchen. «Wir teilen alles miteinander», hält Tertullian in seiner Apologie fest, «ausser unsere Frauen».[6]
Die Philosophen kommen an diese Weltsicht nicht heran. Sie streben wie die Christen nach dem gerechten Leben. Sie halten die Leute dazu an, das Gute zu tun. Nur wollen ihre Quellen nicht so richtig sprudeln. Gut ist in ihren Augen nämlich das, was dem eigenen sozialen Stand dient. Genauso fordern später die Aufklärer Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit, meinen damit aber nur weisse Männer. Für Schwarze, Frauen und Sklaven gelten die modernen Freiheiten nicht. Weder die antiken Philosophen noch die Aufklärer begreifen, dass ihre Weltsicht unter einem Höchstmass an Solipsismus leidet.
Wirkung der Kirche
Die Kirche der Anfänge durchbricht Standesunterschiede. Sie nimmt sich der Armen und Bedürftigen an. Schwache, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, bekommen einen Platz. Zu seiner vollen Entfaltung kommt dieses Mindset in der Spätantike ab dem 3. Jahrhundert als die christliche Religion in hohem Mass organisiert wird. Bischöfe bauen in ihrem Umfeld ein Sozialsystem auf, das in der antiken Welt ihresgleichen sucht und bis in unsere Zeit hineinwirkt. Sie speisen die Armen, bauen Herbergen für Flüchtlinge, errichten Asylheime für Leprakranke und organisieren Crowdfundings zum Freikauf versklavter Christen.
Der Kern dieser neuen Möglichkeit menschlicher Beziehungen ist nicht eine Vision, nicht eine Utopie, nicht ein politisches Programm, sondern eine Person: Jesus Christus.
Paulus sagt es so: «Es ist nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid: In Christus seid ihr alle eins» (Galater 3,28). Dieser Satz ist Ausdruck eines neuen Gesellschaftsverständnisses. Mit ihm beginnt der Gedanke der elementaren Gleichheit aller Menschen in die abendländische Kulturgeschichte einzudringen.
Der Grundton des wachsenden Christentums ist die Agape-Liebe (Johannes 13,34–35). Agape ist die selbstlose, schenkende, barmherzige, geduldige Liebe (Kolosser 3,13). Die Philosophen reden von Eros, Philia und Respekt. Zur selbstlosen Nächsten- und Feindesliebe, wie die Christen sie leben, steigt die antike Tugendlehre nicht auf. Sie kann nicht, weil sie religiös limitiert ist. Es ist egal, wie man als Römer seine Sklaven oder seine Ehefrau behandelt. Religion stellt keine ethischen Anforderungen, für das Alltagsleben ist sie praktisch bedeutungslos.
Ganz anders das Christentum. Wie man seine Sklaven oder seine Ehefrau behandelt, ist von gleichem Gewicht wie das Bekenntnis oder das Gebet. Mit der Verbindung von Dogma und Ethik setzt das Christentum mit seinem wachsenden Einfluss einen Prozess in Gang, der die Humanisierung des Westens ermöglicht.
Eine Ermutigung zum Schluss
Das Vorbild der Urkirche ermutigt mich, den Herausforderungen der Postmoderne zuversichtlich zu begegnen. Die Aussichten für die ersten Christen waren nicht gut. Ihre Botschaft passte nicht in die antike Welt. Die Kirche überzeugte hauptsächlich durch Taten der Nächstenliebe, durch welche ihre Botschaft sichtbar wurde und überhaupt erst verstanden werden konnte. Die ersten Christen widerstanden der Versuchung, anstössige Elemente aus ihrer Botschaft zu entfernen. Ihre klare Theologie wirkte zusammen mit tätiger Nächstenliebe überzeugend.
Die Verhältnisse heute sind nicht anders als damals. Wir müssen uns für unsere klaren theologischen und ethischen Überzeugungen nicht schämen und wir sollten sie mutig vertreten wie damals in den historischen Anfängen des Glaubens. Wenn sie Hand in Hand mit lebendiger Kirche geht, die liebt, die Menschen aus dem Staub hebt, die gesellschaftliche Schranken überwindet, die echte Diversität lebt – dann werden die Vorzüge des christlichen Glaubens sichtbar und Christsein attraktiv.
[1] Victor, Ulrich, Karsten Peter Thiede und Urs Stingelin 2003. Antike Kultur und Neues Testament, 153–158.
[2] Dalheim, Werner 2014. Die Welt zur Zeit Jesu, 319–320.
[3] Platon, Gorgias oder über die Beredsamkeit, 483.
[4] Aristoteles, Politik I,5,1254b; 1,13,1260a.
[5] Holland, Tom 2024. Herrschaft. Die Entstehung des Westens, 56.
[6] Tertullian, Apologie, 39,1ff.
Titelbild: iStock

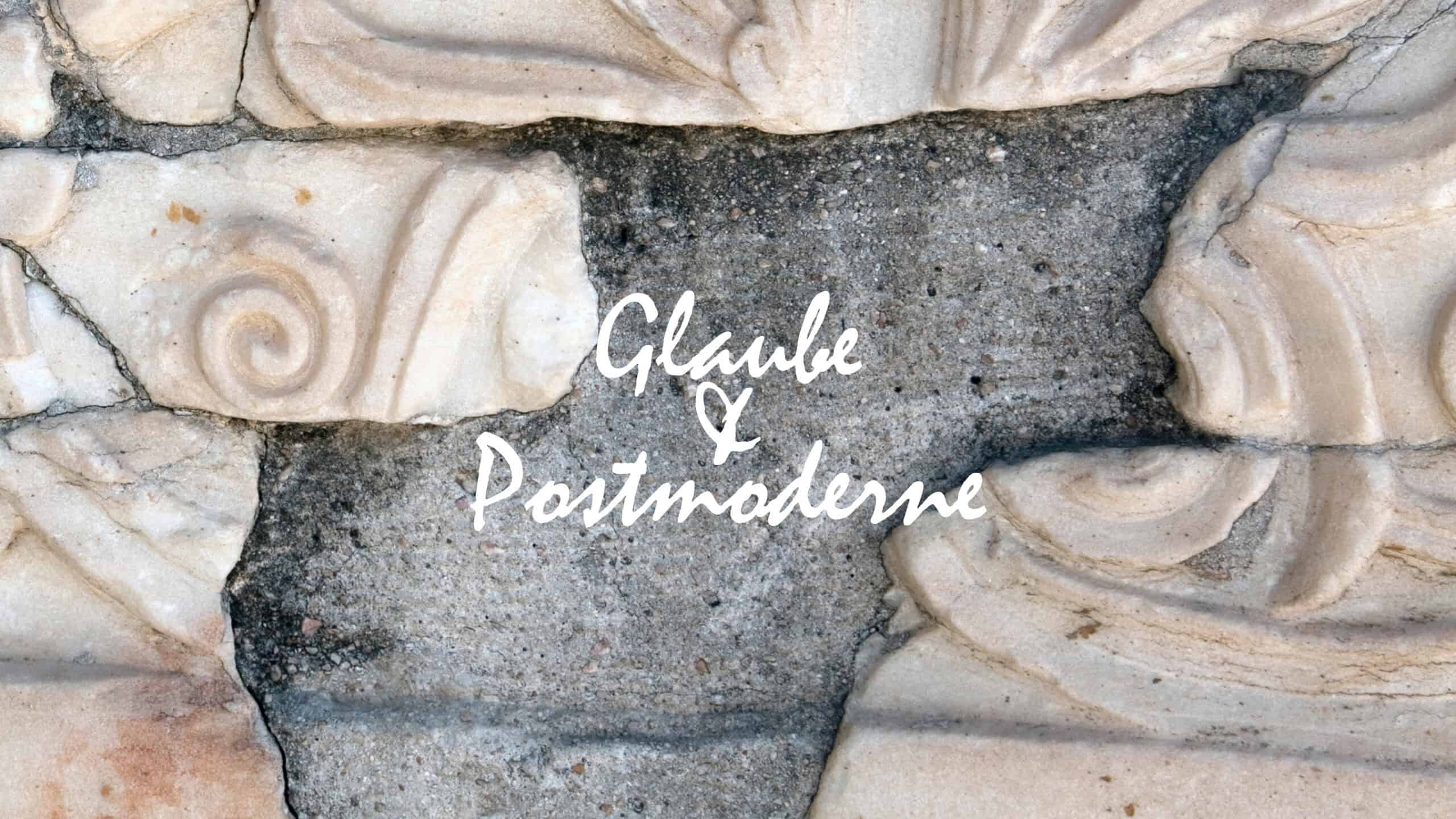

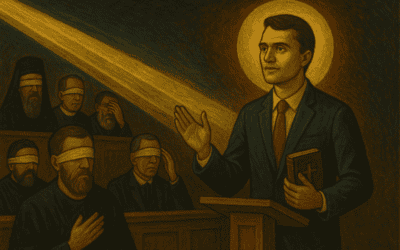


0 Comments